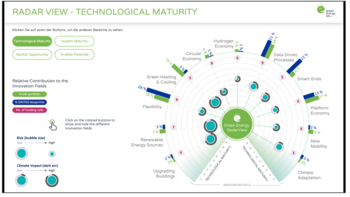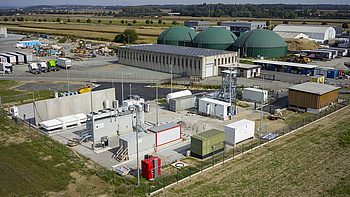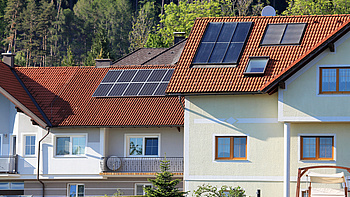Austria Innovativ: Herr Professor, Sie sind seit einem Jahr Vorsitzender des Wissenschaftsrates. Wo sehen Sie die Verortung dieser Institution im Wissenschaftssystem?
Antonio Loprieno: Eine gute Frage. Aus meiner Sicht befindet sich der Wissenschaftsrat in seiner Bedeutung und Verortung in einer Übergangsphase. Meine Erfahrung ist, dass wir zwischen zwei Positionen oszillieren: Wir sind ein wichtiges Beratungsorgan des Wissenschaftsministeriums, in diesem Fall von Vizekanzler Reinhold Mitterlehner. In dieser Rolle übernehmen wir den Part des mahnenden Fingers, weisen auf unserer Meinung nach nicht zielführende Entwicklungen hin und bieten Hintergrundinformation für politische Entscheidungsträger – im Sinne eines recht klassischen Modells von Beratung in universitären Angelegenheiten. Aber andererseits bahnt sich am Horizont eine neue Funktion an. Die österreichische Bildungslandschaft ist in den letzten Jahren viel komplexer geworden, unsere Rolle soll daher auch in breiteren Sektoren spürbar werden und lokalisierbar sein. Da sehe ich unsere Aufgabe als Reflexionsinstanz für Entwicklungen in der österreichischen Wissenschaft und im gesamten Wissenschaftssystem. Diesen Dialog führen wir primär mit der Politik, mit den Rektorenkonferenzen und mit dem FWF. Mir geht es aber auch um einen weitreichenden, konstruktiven Dialog mit anderen Akteuren der Bildungslandschaft. Wir sind also kein in sich geschlossenes Gremium, sondern wollen eine offene Bühne zur Diskussion von gesamtgesellschaftlichen Tendenzen öffnen.
AI: Das heißt, Sie wollen den Wissenschaftsrat einer breiteren Öffentlichkeit zugängig machen. Wo stehen Sie hier mit Ihren Bemühungen?
AL: Sicherlich noch am Anfang, das braucht Zeit, aber das Ziel ist gegeben und nicht zuletzt auch das Ergebnis einer Selbstreflexion, die wir im letzten Jahr durchlaufen haben. Wir versuchen schon jetzt, uns etwas weniger als in der Vergangenheit als Vertretung nur bestimmter Modelle von Universität zu präsentieren, denn heute gelten mehrere solche Modelle. Das wollen wir proaktiver kommunizieren und dabei eine mitgestalterische Rolle übernehmen.
AI: Sie haben ja Ende 2016 den ersten Bericht zu den Privatuniversitäten veröffentlicht. Wie waren da die Reaktionen?
AL: Wenn ich unsere zwei Stellungnahmen der letzten Zeit nehme, so ist die erste Stellungnahme ein wenig im traditionellen Stile gewesen. Medizinische Forschung ist eine eher klassische Thematik, hier haben wir im Geist des mahnenden Fingers die Situation analysiert und hervorgehoben, an welchen Orten etwa Forschung auf höchstem Niveau betrieben wird und wo Nachholbedarf besteht. Die zweite Analyse zu den Privatuniversitäten ist, denke ich, ein Beispiel dafür, dass wir unsere Diskussionskultur erweitern wollen. Man kann unsere Stellungnahme als Sympathiebekundung für die Privatuniversitäten interpretieren. Denn bei aller Berücksichtigung und Verteidigung der Qualitätsmerkmale der österreichischen Wissenschaft gibt es eben auch Aspekte jenseits der reinen Forschung. Kundenorientierung als Schlagwort ist so ein Beispiel: Hierzu hat der private Sektor viel beigetragen. Der innovative Beitrag von FHs und Privatuniversitäten ist sehr wichtig, weil er zu einem Zeitpunkt kommt, als in Universitäten die Forschung ins Zentrum der Aufmerksamkeit rückt, bedingt durch das Aufkommen von Rankings und Leistungsvereinbarungen. Da ist mit den FHs und den Privatuniversitäten die Entwicklung zweier akademischer Produkte zu beobachten, welche die Lehre ins Zentrum der Aufmerksamkeit stellen. Somit leisten die Hochschulsektoren in ihren unterschiedlichen Richtungen und Umfängen jeweils zentrale Beiträge zum österreichischen Hochschulwesen.
AI: Institutsleiterinnen und Institutsleitern monieren oft, der Druck allein zur Grundfinanzierung des Systems sei zu hoch geworden. Wie beurteilen Sie das aus internationaler Sicht?
AL: Ich beobachte, dass Österreich im internationalen Vergleich hier tatsächlich eine Herausforderung hat. Es ist in der Tat richtig, dass Qualifikation und Exzellenz im akademischen Bereich einen Wandel erfahren haben. Das frühere Modell der Kooptation entwickelt sich immer mehr zu einem des Wettbewerbs. Traditionell hatten akademische Entscheidungsträger Anspruch auf Finanzierung, Ausstattung, Assistenzen. Dieses Modell wird allmählich europaweit durch ein evidenzbasiertes, wettbewerbsorientiertes Verständnis ersetzt. Fundraising für die eigene Forschung ist heute elementar. Wenn man in Österreich hört, dass der FWF im Vergleich zum Schweizer Nationalfonds zu niedrig finanziert ist – wobei ich FWF-Präsident Klement Tockner sehr schätze und in all seinen Bemühungen voll unterstütze! – muss man auch sagen, dass die Schweizer Forschung zwar mehr Geld erhält, aber in Österreich ist ein Teil dieses Geldes bereits im Hochschulsystem enthalten, beispielsweise durch Assistenzen, die an Professuren gebunden sind. In der Schweiz finanzieren in der Regel Professorinnen und Professoren ihre Mitarbeitenden durch Mittel aus dem Nationalfonds. Ich finde es begrüßenswert, dass das evidenzbasierte System hier Platz greift. Auch wenn manche Professorinnen und Professoren diese Entwicklung beklagen mögen, ist sie im besten Interesse der Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Universitäten.
AI: Ganz frei von Konflikten sind evidenzbasierte Modellen natürlich nicht, allein wenn man den harten Konkurrenzkampf um Mittel bedenkt...
AL: Ja, es bestehen auch Herausforderungen, weil in jedem evidenzbasierten Modell ein differenzierender Aspekt gegeben ist: Je evidenzbasierter ein Verteilungsmodell, desto größer der Wettbewerb und desto kleiner der Konsens. Österreich ist Land des Konsenses – sogar mehr als die Schweiz, was mich überrascht hat. Im österreichischen Hochschuldenken ist die sektorale Dimension der wichtigste Punkt. Die Tatsache selbst, dass man Universität ist, beansprucht für sich einen gewissen Status, der in einem evidenzbasierten Modell herausgefordert wird. Wenn man nun durch zusätzliche Finanzierungen eine gesellschaftliche Solidarität für die Wissenschaft einfordert, sollte man auch bereit sein zu akzeptieren, dass die Differenzen zwischen Institutionen dadurch nicht kleiner, sondern größer werden.
AI: Wie haben Sie diesen Systembruch bzw. diese Entwicklung in der Schweiz erlebt?
AL: Vor 100 Jahren durfte man an der ETH Zürich nicht promovieren, vor 50 Jahren waren die Schweizer ETHs in ihrer Qualität vergleichbar mit den Schweizer Universitäten. Heute würde jeder Universitätsrektor zugeben, dass die ETHs durch ihre Bundesfinanzierung in einer globalen Liga spielen, während Universitäten auch ihrer lokalen Verankerung verpflichtet sind. In der nationalen Schweizer Kultur ist heute akzeptiert, dass die Einheit der Universitäten durch den Wettbewerb auch ein wenig leidet. Diese Frage ist hingegen in Österreich noch ungeklärt. Es fehlt bis heute eine offene gesellschaftliche Diskussion und Entscheidungsfindung darüber, welches Universitätssystem wir wollen. Als Sektor, öffentlich mit Gießkanne unterstützt? Oder spielen wir die Exzellenzkarte aus und messen wir uns im Wettbewerb mit Singapur oder Boston? Dann muss man auf manches verzichten, das man in der Vergangenheit hatte. Das erfordert eine gebotene Offenheit.
AI: Und wie werden Ihre Ideen von den anderen Akteuren im Wissenschaftssystem aufgenommen?
AL: (lacht) Das müssen Sie die anderen fragen. Ich denke, man räumt mir noch eine gewisse Faszination des Exotischen ein. So nach dem Motto: Er hat schon recht, aber es ist noch nicht lange genug bei uns, um alles zu verstehen. Ich denke aber, dass viele Kolleginnen und Kollegen mir Recht geben werden. Die Freiheit des Denkens ist allerdings in meiner Position ungleich größer, als wäre ich beispielsweise uniko-Präsident. Generell denke ich aber, dass ein frischer Wind von Politik bis Akademie für gut befunden wird.
AI: Ein leidiges Thema ist die Finanzierung der Unis. Reicht es einfach zu sagen, die Unis brauchen mehr Geld vom Staat?
AL: Im Gegenteil! Universitäten könnten mehr aufbringen, indem sie ihre Autonomie besser wahrnehmen und sich weniger auf Beiträge des Staates verlassen – nicht mehr. Dazu müssen sie die Exkursionen in den privaten Sektor erhöhen. Autonomie impliziert die Fähigkeit, zwischen verschiedenen finanziellen Abhängigkeiten entscheiden zu können. Die österreichische Autonomie ist eine Einbahnautonomie von Staats wegen. Also ist es schwierig, von Autonomie wirklich zu sprechen, denn der Prinzipal – also der Bund – hat durchaus das Anrecht, von seinen Agenten – den Universitäten – eine bestimmte Leistung zu erwarten. Es ist letzten Endes eine merkwürdige Autonomiesituation, in der wir uns in Österreich befinden.
AI: Wie lässt sich das ändern?
AL: Indem die Universitäten Finanzierungsfälle entwickeln, die dazu führen, dass sich beispielweise die Universität Graz auch in ihrer Finanzierung von der Universität Wien unterscheidet. Das heißt, ich muss für meine Universität einen größeren Gestaltungsraum selbst entwickeln. Derzeit sehen wir eine Ausblendung des Standortfaktors durch mangelnde Mobilisierung der Landesregierungen – die finanzieren dafür jetzt Privatuniversitäten, die deshalb oft nicht wirklich sind. Diese One-Way-Street mit dem Bund sollte aufgelöst werden. Es ist für eine Universität keine Schande, eine nicht nur globale, sondern auch lokale Funktion zu erfüllen. Daher sollten auch die österreichischen Universitäten beispielsweise eine größere Nähe mit Landesregierungen etablieren und mit Privatuniversitäten kollaborieren. Denn bisher bleibt das Engagement des nicht-staatlichen Sektors unterentwickelt.
AI: Was nicht zuletzt auch auf unterschiedliche Kulturen in Europa und den USA zurückzuführen ist....
AL: ...ja, bis jetzt hatten Privatinvestoren in Österreich die Privatunis im Fokus. Aber hier wäre noch viel möglich. Es sollte doch in Österreich möglich sein, endlich privates Geld in das Bildungswesen einfließen zu lassen. Wäre die Welt perfekt, dann wäre diese Form der Intervention letzten Endes jene, die zu einer klaren Verbesserung der bestehenden Institutionen führen würde. Und wir hätten am Ende eine intensive, standortorientierte Zusammenarbeit von durch Bund und Ländern finanzierten Bildungsstätten.
AI: Bleibt die Frage, ob sich solche Ideen im österreichischen Föderalsystem umsetzen lassen.
AL: Ach, der Föderalismus ist auch in der Schweiz problematisch. Dort spürt man jedoch die negativen Seiten noch nicht so. Denn unsere Kantone haben eine Dimension, in der man den Föderalismus im Sinne des Wettbewerbs begrüßen kann. Dafür ist jedoch eine ausreichende kritische Größe und Masse wichtig. Aber man merkt es natürlich auch in der Schweiz, wenn der Kleingeist Regie führt: Der liebe Gott hat Basel so sehr geliebt, dass er gleich zwei Regierungen eingerichtet hat – für Basel Stadt und Basel Land. Bei der letzten Volksbefragung war Basel Stadt war für die Fusion der Kantone, Basel Land war dagegen. Schade aus meiner Sicht, denn das verkompliziert Basels Behauptung im Wettbewerb mit Zürich oder Bern. Das geschieht, wenn der Standort, die Bühne der Auseinandersetzung im Sinne der kritischen Masse zu klein ist. Die Uni Wien profitiert z.B. sowohl von ihrer Größe als auch von ihrem zentralen Standort. In diesem Sinne ist Österreich weniger föderalistisch als die Schweiz.
AI: Nun haben Sie viele gute Ideen, sind aber natürlich aufgrund Ihrer beruflichen Tätigkeit nicht täglich in Österreich. Wie managen Sie das?
AL: Der Zeitfaktor ist tatsächlich ein Thema. Anders als mein Vorgänger bin ich ja noch Vollzeitprofessor, es ist daher einigermaßen anspruchsvoll, Präsenz zu zeigen und Außenwirkung zu erzielen. Aber ein Präsident muss nicht in der Tagesarbeit präsent sein, das wird von unserer Geschäftsstelle sehr gut wahrgenommen. Öffentliche Präsenz und Stellungnahmen sind jedoch wichtig, um das Organ an sich sichtbarer zu machen.
AI: Braucht es denn wirklich so viele Beratungsgremien, wie wir sie in Österreich haben?
AL: Ich habe festgestellt, dass im Wissenschaftsrat und dem Rat für Forschung und Technologieentwicklung eine durchaus positive Kultur der Abgrenzung zum jeweils anderen Rat besteht. Wir sind alle Menschen, man sieht die eigene Funktion als „wichtiger“ an. Aber wir stecken unsere Terrains sehr gut ab. So habe ich mit RFTE-Vorsitzendem Hannes Androsch, den ich sehr schätze, vereinbart, dass wir unsere Zusammenarbeit intensivieren und dass auch die Räte stärker untereinander in Verbindung treten. Ich betrachte es als Anliegen, dass bei aller Berücksichtigung der unterschiedlichen Positionen nie der Eindruck entsteht, dass Doppelgleisigkeiten vorhanden wären. Daher müssen wir unsere Themenfelder streng rausarbeiten und auch so positionieren.
AI: War Ihre Berufung auch das Signal einer Systemerneuerung?
AL: Ich halte es für wesentlich festzuhalten, dass das österreichische System in qualitativer Hinsicht beispielsweise zur Schweiz sehr wohl vergleichbar ist, aber früher doch zu sehr in Eigenregie geführt wurde. Konservative Elemente wurden sehr gepflegt, das ist mein Eindruck von außen. Bestimmte Berufungen – beispielsweise jene von Klement Tockner, aber wohl auch meine – zeigen aber, dass es Wunsch der Politik und Gesellschaft ist, neue Zeichen im Sinne einer personellen Auffrischung zu setzen. Wichtig ist mir auch, dass wir Themen behandeln, für die sich die akademischen Institutionen interessieren, nicht allein eine kleine Gruppe von Stakeholdern – also wirklich systemrelevante Aspekte!