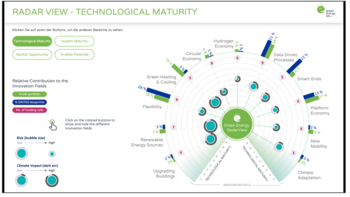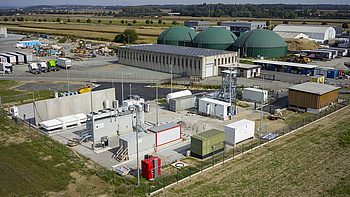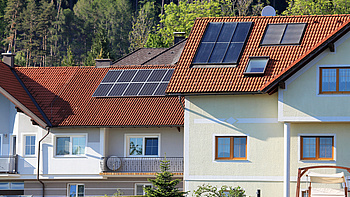Hauptredner, Univ.-Prof. Markus Hengstschläger, Vorstand der Abteilung für Medizinische Genetik an der Medizinischen Universität Wien, brachte es bei seinem Impulsreferat gleich zu Beginn der Diskussion mit einer einfachen Gleichung auf den Punkt: Wenn eine/r die Axt nimmt und mit dieser die Familie erschlägt, wird am nächsten Tag natürlich niemand fordern, die Axt zu verbieten. Denn die Axt als solche sei neutral. Erst die Anwendung entscheidet über Gut oder Böse. Analog gelte dies eben auch für die Forschung.
„Das mag für eine Axt stimmen, stimmt aber nicht mehr für die Forschungsresulta- te, wie wir sie heute haben,“ kontert Univ.- Prof. Peter Kampits, Dekan der Fakultät für Philosophie und Bildungswissenschaften der Universität Wien. „Das Axiom, dass das wissenschaftliche Resultat jenseits von Gut und Böse steht, lässt sich nicht mehr aufrechterhalten.“ Denn die Zeit, in der die Wissenschaft sich selbst als wertfreien Raum verstanden habe, sei längst vorbei. Es funktioniere nicht mehr „dass der Wissenschaftler/ die Wissenschaftlerin sagen kann, ich bewege mich in einem wertfreien Raum, ich beschreibe nur Vorgänge der Natur und was dann damit gemacht wird, enthebt mich jeder Verantwortung“.
Tatsächlich habe Österreich dringenden Handlungsbedarf für eine Normierung der Forschung, so die Vorsitzende der beim Bundeskanzleramt angesiedelten Bioethikkommission, Christiane Druml. Ob sichere, gesunde Lebensmittel oder der Umgang mit Embryonen und Stammzellen – immer noch werden hierzulande ethisch heikle Fragen – wenn überhaupt – an einzelne Ethikkommissionen delegiert, deren Empfehlungen dann ungehört verhallen. Dass aber eine entsprechende Rechtssicherheit in Österreich überfällig sei, meinten nicht nur zahlreiche ReferentInnen bei einem kürzlich stattgefundenen Chirurgenkongress in Linz, das war auch die einhellige Meinung der PodiumsdiskutantInnen im Rahmen des AUSTRIA INNOVATIV-Forums. Bioethik- und auch Forschungsethikkommissionen wenden sich zwar des Öfteren mit Stellungnahmen und Dokumenten an die Politik, aber, so Christiane Druml: „Die Politik sollte diese Ergebnisse auch endlich abholen“, dies funktioniere aber noch nicht.
Ethik ist nicht Moral klärte Univ.-Prof. Peter Kampits die rund 70 interessierten ZuhörerInnen der Podiumsdiskussion auf, stehe grundsätzlich über dem Gesetz, mache dieses aber nicht obsolet. Wie sehr die Moral von der Evolution, unseren Wertevorstellungen und dem kulturellen Umfeld abhängt, illustrierte Peter Kampits mit einem Beispiel Arthur Schopenhauers: „Stachelschweine halten bekanntlich Winterschlaf. Rücken sie zu nahe zusammen, drohen tödliche Verletzungen, sind sie zu weit voneinander entfernt, fehlt die wärmende Nähe um zu überleben. Erforderlich sei daher ein exakt definierter mittlerer Abstand, den sie instinktiv einnehmen – und in diesem Spannungsfeld bewege sich Moral.“ Ethik ist die Reflexion auf die Moral. Und so kommt es mitunter zur alles entscheidenden Frage: „Warum soll ich moralisch sein?“ Dass der kategorische Imperativ von Immanuel Kant heute oftmals nicht mehr das Maß aller Dinger sein kann, konzidierte auch der Ethik-Experte.
Die Wissenschaft könne nicht wertfrei betrachtet werden, es gebe dafür zu viele – oft auch unbewusste – Kodices durch Bibel, Menschenrechte, juristische Normen. All das löse vielleicht nicht konkrete Fragestellungen einzelner Personen, zusätzlich gibt es in Zeiten des Wertepluralismus keine übergreifende Richtschnur. Die Wissenschaft dürfe – ethisch korrekter ausgedrückt „sollte“ – keine Parallelwelt zur Ethik schaffen, meinte Christiane Druml, aber gerade moderne Wissenschaften wie die Genetik bedürfen rechtsstaatlicher Klärungen, um akzeptabel zu sein.
Bei der etwas heiklen Frage, ob denn Ethik in bestimmten Fällen auch über dem Gesetz stehen könne, war sich die Diskussionsrunde uneinig. Während dies Peter Kampits – vor allem beim Thema „Sterbehilfe“ – unter gewissen Bedingungen so sieht, war den anderen TeilnehmerInnen diese Formulierung zu strikt. Klar wurde allerdings, dass Ethik-Überlegungen den nötigen Impuls geben sollten, durch gesetzliche Regelungen Grauzonen für Gesellschaft und Forschung so weit wie möglich zu minimieren.
Grauzonen gäbe es nämlich noch genügend, attestierte der Vorsitzende des Forums Österreichischer Ethikkommissionen, Univ.-Prof. Peter Rehak, – vor allem beim Thema Forschung/medizinischer Behandlung an nicht einwilligungsfähigen Personen. Allein schon die simple Blutabnahme an einem Kind sei etwa eine solche Grauzone. Denn wenn damit kein direkter Nutzen für das Kind erkennbar ist, dürfen auch dessen Eltern keine Einwilligung geben. Noch krasser ist der Fall, wenn es sich etwa um eine Blutabnahme handelt, um eine Erbkrankheit in der Familie zu diagnostizieren, um das Risiko des Auftretens dieser Krankheit in den nächsten Jahrzehnten abzuschätzen. Aus ethischen Überlegungen wäre das durchaus sinnvoll, aus praktischen aber nicht, da der Arzt in diesem Fall straffällig wird.
Ähnlich Komplex sind Fragestellungen bei der Stammzellenforschung. Letztlich wird dabei in vielen Fällen die Frage gestellt, wann das Leben beginnt. In katholischen Ländern wird diese Frage anders entschieden als in jüdisch oder islamisch geprägten Staaten. Forschung ist aber heute in hohem Maße grenzüberschreitend. Weil embryonale Stammzellen etwa in Deutschland nur bis zu einem bestimmten Stichtag für weitere Forschungszwecke genutzt werden können, behilft man sich in hohem Maße mit Stammzellen aus Israel – dort beginnt nach Glaubensüberlegungen das Leben erst nach dem 40. Tag der Schwangerschaft.
Mit den zehn Geboten allein lassen sich heutige Probleme jedenfalls nicht mehr klären, stellte Markus Hengstschläger klar. Und kritisierte damit zugleich manche Überlegungen von Ethik-PhilosophInnen, die jahrhundertealte Dogmen auch für heutige Thematiken zu Rate ziehen. Die Lösung des gordischen Knotens für Hengstschläger: „Alles muss beforscht werden. Aber: Ist jeder Weg, ist jedes Werkzeug gerechtfertigt?“ Bei der Forschung geht es demnach um Wege und Werkzeuge, die ethisch gerechtfertigt sein sollten. Und bei der Anwendung von Forschungsergebnissen müsse es Systeme geben – in der Community „Asbestfaktor“ genannt –, die Auswirkungen rückgängig machen können, wenn sich daraus Irrwege ergeben. Das mache vor allem der „grünen Gentechnik“, also der Genforschung an Pflanzen, Probleme.
Hengstschläger: „Wir leben heute nach wie vor auch von Daten, die aus der Zeit zwischen 1938 und 1945 stammen. Dieser Weg, an Forschungsresultate zu kommen, gilt als die widerlichste Fratze unethischen Verhaltens. Tschernobyl ist ein anderes Beispiel. Die Auswirkungen dieser Katastrophe waren für uns Wissenschaftler natürlich im Hinblick auf die davor unerforschten Langzeitauswirkungen enorm hilfreich. Auch wenn wir uns in beiden Fällen gewünscht hätten, dass dies niemals passiert wäre.
Die Freiheit der Forschung wurde auch von Peter Kampits bejaht, dennoch sei er in einer Zwickmühle: „In manchen Bereichen – etwa bei der Genetik – könnten Grenzen überschritten werden, die uns letztlich zwingen, das Menschsein neu zu definieren.“ Helfen könne hier nur die Aufforderung, dass jede/r einzelne ForscherIn ihr/ sein Tun rechtfertigen muss und ein Gespür dafür entwickelt, wo die Grenzen liegen. Zum generellen Stellenwert der Ethik merkte Kampits aber auch an, dass sie in unseren Tagen auch zur Handbremse im Interkontinentalflieger werden kann, da unterschiedliche nationale ethische Rahmenbedingungen im globalen Standortwettbewerb um die führenden Forschungs-Hot-Spots natürlich auch Nachteile bringen.
Doch spiegelt die aktuelle rechtliche Situation auch die moralische Einstellung der Bevölkerung wider? Eine Eurobarometer-Umfrage zeigte, dass mehr als die Hälfte der Österreicher Untersuchungen an Embryonen gänzlich ablehnen, die etwa auf genetische Indikatoren für Intelligenz abzielen. Jedoch waren 18 Prozent unter der Bedingung, dass dies streng reguliert und kontrolliert von Statten geht, nicht abgeneigt. Damit liegen die Österreicher im EU-Durchschnitt. Beachtlicherweise verhält es sich zahlenmäßig nahezu gleich, wenn man von Gentests spricht, die helfen könnten, einen Nachkommen zu (er)zeugen, der einem lebensbedrohlich kranken Geschwister mit einer Knochenmarksspende das Leben retten kann. Gegenüber den 50 Prozent der ablehnenden ÖsterreicherInnen, finden sich in diesem Fall im EU-Raum jedoch nur 34 Prozent Gegner.