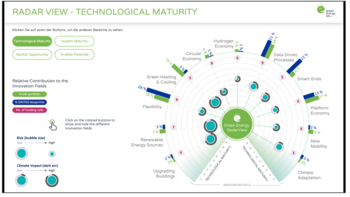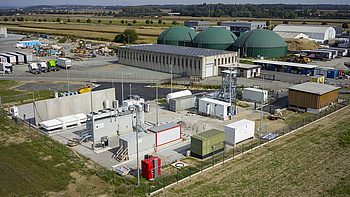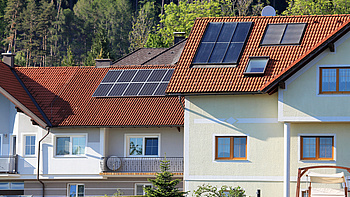AI: Warum kehrt man als Forscherin oder Forscher wieder zurück nach Österreich?
Georg Danzl:
Ich habe mich vor zwei Jahren in Klosterneuburg am IST Austria beworben. Ich kannte das Institut vom Hörensagen, hatte danach im Berufungsverfahren Gelegenheit, es im Rahmen eines zweitägigen Besuchs besser kennenzulernen – und war sehr beeindruckt von der Qualität der Interaktion mit den künftigen Kolleginnen und Kollegen. Als Forscher sucht man ein stimulierendes intellektuelles Umfeld. Ich bin zwischen den Disziplinen angesiedelt und möchte auch in einem interdisziplinären Umfeld tätig sein. Letztlich muss man bei jeder Entscheidung über das Institut an sich hinausblicken. Und da sind der nahegelegene Wissenschaftsstandort Wien und vor allem die Interaktionen mit und in Wien interessant. Zudem haben wir ein sehr professionell geführtes Drittmittelsystem in Österreich. Hier ist eine Wertschätzung gegenüber der Wissenschaft vorhanden, die man auch sucht und braucht. Man geht gerne als Forscher nach Wien.
Notburga Gierlinger:
Wien ist einer der größten Forschungsstandorte, an denen ich bisher war. Es ist einer mit sehr großer Vielfalt. Für mich ist beispielsweise charakteristisch, dass es sehr viele Studierende gibt. Das war auch der Grund, warum ich nach dem Studium in Salzburg sofort nach Wien ging. Hier gibt es sehr gute Chancen auf ein Aufbaustudium, vielfältige Angebote, mehrere Möglichkeiten der Dissertation. Wien ist für den Start einer Forscherkarriere mit unzähligen Möglichkeiten ausgestattet und so habe ich in Wien auch meine Dissertation gemacht. Danach war ich sechs Jahre im Ausland. Es war dann gar nicht so leicht, zurückzukommen. Ich habe in Linz und dann an der BOKU gearbeitet, aber mir haben das Umfeld und die Freiheit gefehlt, letzten Endes auch die Mittel. Daher ging ich 2014 wieder an die ETH und baute dort als Oberassistentin eine Gruppe mit auf. Ich habe kurz vor meiner Abreise noch beim START eingereicht – und kam nach zwei Jahren eigentlich nur wegen des START-Programms zurück. Hier habe ich die tolle Möglichkeit, eine Gruppe aufzubauen und auch entsprechende Geräte zu bekommen. Die BOKU ist nicht überragend mit Mitteln ausgestattet, daher ist es für mich essenziell, den START-Preis und einen ERC-Grant zu haben. Ohne diese beiden könnte ich nicht so gut in Wien wirken, wie ich das im Ausland konnte.
Klement Tockner:
Ich bin mehrmals weitergezogen und dass ich heute hiersitze in dieser Position, war nie geplant. Man kann Karrieren nicht planen. Man hat Opportunitäten, die man nützen muss. Mir war anfangs nicht klar, ob ich in der Wissenschaft bleibe oder andere Wege einschlage. Ich war sieben Monate in Ruanda in einem großen Entwicklungshilfeprojekt involviert und habe dort den Zustand der Gewässer erforscht. Es kam dann das Angebot einer UN-Organisation, nach Tansania zu gehen. Insofern könnte ich heute ganz woanders sitzen. Für mich der größte Entscheidungsschritt war sicherlich die Oberassistenz an der ETH – das bekommt man nur einmal, das muss man nutzen und daraus was machen. Es ist wichtig, stets selbst entscheiden zu können, ob man nach links oder rechts abbiegt. Von dieser Seite sehe ich den Begriff „Zurückkehren“ nach Österreich auch differenziert: Ich bin als Europäer einfach einen Schritt weitergegangen. Es war ein Privileg, an der ETH zu sein und es ist ein Privileg, jetzt in einer ganz anderen Verantwortungsposition hier in Österreich zu sein. Der FWF hat ein Riesenpotenzial. Wir haben den großen Willen, etwas voranzubringen. Forschungsstädte wie Wien, Innsbruck, Graz oder Linz haben großartiges Potenzial. Die Frage ist: Wie kann man das heben und nach vorne bringen? Dazu braucht es Vertrauen in Leute und Institutionen. Denn Vertrauen ist die wichtigste Währung in der Wissenschaft, um eine gewisse Planbarkeit hereinzubekommen.
Markus Valtiner:
Mein Tipp für junge Forschende ist, den Blick möglichst früh ins Ausland zu richten und somit seinen Horizont zu erweitern. Qualitativ bestmögliche Post-Graduate- Ausbildungsmöglichkeiten und Forschungsmöglichkeiten sind essenziell für die Weiterentwicklung. In der Grundlagenforschung gibt es international bessere Möglichkeiten als in Österreich. 30-40 Prozent der Forschungsgelder an deutschen Unis werden für Grundlagenforschung investiert. Da haben wir einen Wettbewerbsnachteil. Also: Nach draußen gehen! Für kleine Länder wie Österreich ist das besonders wichtig, denn wir haben nur wenige oder gar keine Experten in gewissen Fachgebieten. Um auf einem hohen Level international arbeiten zu können, muss man manchmal rausgehen – und bringt auch neue Ansätzen und Techniken mit, wenn man weiterzieht oder zurückkommt. Das ist deshalb so wichtig, weil die Post-Doc- und Doktorats-Zeit die zentralen Zeitpunkte in einer Forscherkarriere sind. Man muss sich zukunftsweisende Themen suchen, und die findet man oft im Ausland. Eine wissenschaftliche Karriere ist international und mit Mobilität verbunden. Sichere Arbeitslätze und Planungssicherheit gibt es oft erst später. Daher muss man opportun sein. Das Wichtigste sind das Umfeld und die Möglichkeiten. An der TU Wien gibt es internationale renommierte Oberflächenforschungsinstitute. Wien gilt als renommierter Standort. Letzten Endes geht es um die Umgebung und die Bedingungen, die müssen stimmen. Generell ist zu sagen, dass die Grundlagenforschung in Österreich noch einen Boost bekommen sollte.
AI: Welche Zutaten braucht es für einen vitalen und international ankerkannten Forschungsstandort?
Danzl:
Wesentliche Komponente ist die Interaktion, die man mit Kolleginnen und Kollegen an einem Standort haben kann. Man will und soll sich im positive Sinne mit dem Besten messen. Man steht international in einem dynamischen Wettstreit, die anderen schlafen auch nicht. In der forschenden Umgebung zählen die Qualität der Institution, die infrastrukturelle Ausstattung sowie das unmittelbare wissenschaftliche Interaktionsfeld. Dazu braucht es Mittel, um die Ideen umzusetzen. Forschung ist teuer und braucht viele Ressourcen. Aber es bringt hohen Return on Investment, es lohnt sich für die Gesellschaft, weil diese im Innovationswettstreit vorne mit dabei sein kann. Es braucht das Vertrauen in die Ideen, die man hat. Da können Institutionen sehr viel machen, das FWF-START-Programm ist ein gutes Beispiel. Ich selbst habe als Doktorand in einem START-Programm mitgewirkt.
AI: Rund 25 Prozent der Forschenden sind Frauen. Ist es für Frauen schwieriger als für Männer, in der Forschung Karriere zu machen?
Gierlinger:
Ich glaube nicht, dass es woanders leichter ist, wobei die Rahmenbedingungen für Frauen und Männer gleich gut sein müssen. Es braucht zuallererst eine gewisse Freiheit. In meiner Zeit am Max-Planck-Institut und an der ETH konnte ich Dinge einfach probieren und machen – das ist für eine Forscherin wunderschön und wichtig. Ich versuche das auch meinen Studierenden zu ermöglichen. Ich denke, Frauen haben es mit der Mobilität schwerer. Meistens gehen die Frauen mit dem Mann mit. In Endeffekt bleiben weibliche Karrieren in der Verbindung von Familie und Forschung meistens auf der Strecke.
Tockner:
Wir haben zwei Programme für frühe Stadien, um einen hohen Anteil von Frauen in Forschung bekommen. Die Post-Doc-Phase ist jene, in der man den größten Freiraum als Forscherin oder Forscher hat. Im Schrödinger-Programm haben wir heute rund 50 Prozent Frauen. Und rund 60 Prozent aller Schrödinger-Stipendiaten haben binnen 10 Jahren eine Professur irgendwo auf der Welt. Die Zukunftsprofessuren sollen dabei helfen, prekäre Situationen zu entschärfen. Unser Ziel ist es hier, 50 Prozent Frauen zu gewinnen.
AI: Welche Aufgaben hat der Forschungsstandort Österreich zu bewältigen? Wo muss die FTI-Politik ansetzen?
Valtiner:
Auf jeden Fall ist das FWF-Budget zu niedrig, ebenso die Förderquote. Grundsätzlich ist die österreichische F&E-Quote nicht schlecht, aber in den Grundlagenwissenschaften ist es einfach zu wenig. Die industrielle Förderung ist da auch im internationalen Vergleich sehr viel besser. Ich war früher beispielsweise in einem CD-Labor im Ausland, weil es dafür keine Expertise in Österreich gab. Das kann sinnvoll sein für die Industrie, da sind wir gut aufgestellt. Und noch ein Gedanke: Bei Berufungen in Deutschland ist es schon beinahe üblich, dazu auch Großgeräte zu erhalten. Das gibt es bei uns nicht. Es wäre schön, wenn man bei uns bei einer Berufung auch Großgeräte erhalten würde.
Tockner:
Innovationsländer oder solche, die nahe dran sind, investieren sehr viel in die Grundlagenforschung. Nur so können Durchbrüche in Wissenschaft und Wirtschaft geschehen. In der Schweiz oder in Holland wird sehr viel mehr für die Grundlagenforschung aufgewendet. Auch unsere östlichen Nachbaren ziehen nach: Tschechien investiert kaufkraftbereinigt schon fast genau soviel wie der FWF, Polen hat die Grundlagenforschung in den letzten Jahren verdreifacht. Hier bewegt sich sehr viel. Es besteht aber auch in Österreich großer Konsens, dass hier nachgezogen wird.
AI: Wie attraktiv ist Österreich im internationalen Vergleich als Anziehungspunkt für Forscherinnen und Forscher?
Danzl:
In Österreich gibt es extrem attraktive Plätze für die Forschung. Ich war früher in Innsbruck bei den Quantenphysikern, dort wird vieles richtig gemacht, ebenso am IST Austria. Das zeigt sich beispielsweise im Berufungsverfahren: Man nimmt Leute, die zum Umfeld passen, die berufen werden wollen, weil sie etwas geleistet haben und künftig leisten wollen. Das macht es attraktiv. Klar ist: Österreichische Jungforscherinnen und -forscher müssen hinaus! Ja, danach wird alles unplanbar, man weiß nicht, wo man in ein paar Jahren sein wird oder ob man nach Österreich zurückkommt. Aber man weiß, man setzt einen weiteren Schritt in eine exzellente Umgebung – das ist ein wichtiger Motivator. Und das funktioniert auch in Österreich sehr gut.
Tockner:
Flache Hierarchien sind wichtig, beispielsweise: Wie schaut die Doktorandenausbildung oder –förderung aus? Jemanden für drei Jahre anzustellen und dann zu sagen: Danach musst du weiterziehen, ist durchaus OK. Es ist nicht im Sinne der Leute, an einem Standort zu lange zu verharren.
Danzl:
Doktoranden müssen gehen, Post-Docs müssen gehen. Das ist nicht bequem, aber das muss Wissenschaft auch nicht sein. Dieser Prozess hält die Dynamik aufrecht. Man kann danach die volle Verantwortung übertragen bekommen – das kann auch ein kleines Team sein, in dem man viel bewegen kann. Man muss das Tenure Track System kompromisslos leben. Am IST haben wir das so implementiert. Eine Berufung auf eine Position erhält damit enormen Stellenwert. Es wird viel Zeit und Energie in diese Berufungen gesteckt. Es geht auch nur so.
Valtiner:
Das IST Austria ist für mich ein gutes Beispiel für den neuen Mindset in Österreich, der merklich dynamischer geworden ist. Wir sehen immer mehr internationale Berufungen, nicht notwendigerweise mit österreichischer Staatsbürgerschaft – die besten Köpfe zählen! Das wird auch künftig verstärkt der Fall sein müssen.
AI: Welche persönlichen Voraussetzungen müssen junge Forschende für eine internationale Karriere mitbringen?
Gierlinger:
Man muss sich zu 100 Prozent darauf einlassen. Es geht nur ganz oder gar nicht. Drei Monate Auslandsaufenthalt ist etwas, von dem man nicht viel profitieren kann. Jede Station war für mich auf andere Art und Weise wichtig.
Tockner:
Für mich haben meine Stationen stets eine wissenschaftliche, persönliche und auch familiäre Bereicherung gebracht. Meine Kinder haben es in Amerika großartig gefunden. Man schaut nie zurück, man schaut immer nach vorne. Man macht es oder man macht es nicht.
Valtiner:
Für eine Forscherkarriere muss man auch privat flexibel sein, gleiches gilt für die Partnerin oder den Partner. Man muss offen sein. Mein Freundeskreis ist heute über die halbe Welt verteilt. Es ist schwierig, aus dem bekannten sozialen Umfeld rauszugehen – aber es bringt was.
Danzl:
Wissenschaft ist unplanbar, das ist für Familien eine große Herausforderung. Meine damalige Freundin und heutige Frau und ich wollten beide hinaus. Sie ist Ärztin, wir waren nicht am gleichen Standort, ich war in Göttingen, sie in Berlin – fünf Jahre haben wir das so gelebt. Wir hatten beide das Gefühl, so jeweils die besten Entwicklungsmöglichkeiten zu haben. Das hat sich bewahrheitet. Manchmal macht man als Wissenschaftler Dinge, die für andere nicht ganz nachvollziehbar sind. Letztlich ist es sehr spannende und privilegierte Tätigkeit, dass man seinen Interessen nachgehen kann – systematisch, aber von Neugierde getrieben.
Die gesamte Diskussion zum Nachhören finden Sie hier: